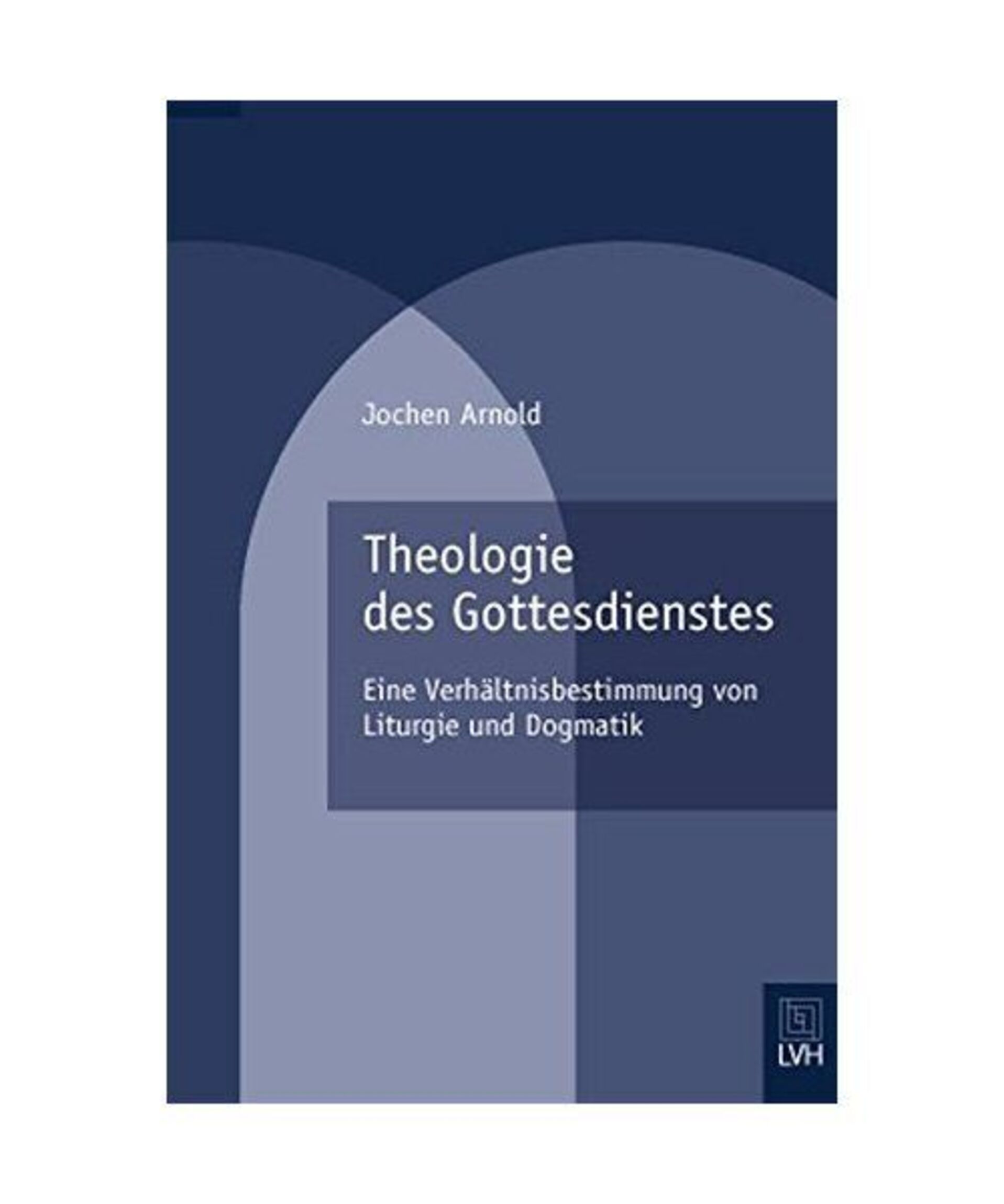Das "Auf" und "Nieder" der Gottesdienstgemeinde
Grundsätzlich sollte jeder Gottesdienst an jedem Ort zu jeder Zeit einen einladenden Charakter haben. Die frohe Botschaft, von der im Gottesdienst die Rede ist, lebt davon, dass sie geteilt wird – und das nicht nur mit Insidern. "Mission" wäre an dieser Stelle das richtige Stichwort.
Jeder Gottesdienst ist auch eine Art von "Mission"
Auch wenn der Gebrauch dieses Begriffes im evangelisch-landeskirchlichen Kontext eher unpopulär ist, beschreibt "Mission" doch zutreffend den Auftrag, den jede Kirchengemeinde auch durch ihre Feier von Gottesdiensten wahrnimmt. Der missionarische Charakter eines Gottesdienstes schlägt sich auch darin nieder, dass er in seiner Gestaltung nicht exklusiv ist, sondern auch diejenigen inkludiert, die (noch) nicht zur Gemeinde gehören.
"Bewegungs-Cchoreographie" ruft manchmal Unsicherheiten hervor
Dem scheint die "Bewegungs-Choreografie" der Gottesdienstgemeinde oft im Wege zu stehen, da sie Unsicherheit und Unbehagen hervorruft bei all jenen, die mit dem gemeindlichen "Auf" und "Nieder" nicht so vertraut sind. Doch nur, wer sich im Gottesdienst sicher und gut aufgehoben fühlt, kann sich auch dem in ihm verkündigten Inhalt öffnen.
Mit dezenten Gesten die Gemeinde sanft durch den Gottesdienst führen
Der Unsicherheit von jenen, die Gottesdienste besuchen, lässt sich auf verschiedene Weise begegnen. Zum einen sind die Liturginnen und Liturgen eingeladen, mit dezenten Gesten die Gemeinde sanft durch den Gottesdienst zu führen. Auch entsprechende "Regieanweisungen" in einem gedruckten Gottesdienstplan können Sicherheit vermitteln.